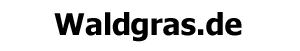Wald und Wild oder Gedanken zur Rehwildhege
29.01.2013 - , BM

#Direkt zur Erläuterung der Regel
„Die Klage über den Rückgang des Rehwildes an Körperstärke und Gehörn ist ein ständiger Gegenstand der Unterhaltung in den Jagdzeitschriften und den Gesprächen der Weidmänner. Der Eine weiß diesen Erklärungsgrund, der Andere jenen; häufig wird festgestellt, daß die Erscheinung erst in neuerer Zeit schärfer hervorgetreten ist, daß heute nur elende Gehörne erbeutet würden, wo noch vor 30 Jahren die stärksten Stangen häufig waren ...“
So schreibt Ferdinand von Raësfeld vor über hundert Jahren[1]. Die Probleme sind also alt und vielschichtig und sollen im Folgenden aufgezeigt werden. Des Waidmanns Ziele, egal wie verschieden die Meinungen auch seien, waren stets eine hohe Rehwildpopulation, gut an Körperstärke und am Gehörn. Der Mensch will, wie kann es auch anders sein, immer alles auf einmal.
Das aktuelle deutsche Bundesjagdgesetz[2] formuliert im §1, Abs. 2: „Die Hege hat zum Ziel die Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepaßten artenreichen und gesunden Wildbestandes sowie die Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlagen ...“
Die Lippenbekenntnisse von Land- und Forstwirtschaft, wie auch der Jägervereinigungen, sind heute die gleichen. Das war nicht immer so und die Parole hieß daher zu Feudalzeiten “Wild vor Wald“. Und war die oekonomische Parole bald „Wald vor Wild“, so heißt es heute endlich „Wald und Wild“ – nur umgesetzt werden muss es noch. Vor dieser Umsetzung des gemeinsamen Zieles gibt es noch ein paar Probleme. Diese Probleme sind einerseits menschlicher Natur und die Probleme der Praxis.
Zunächst die allgemeinen, die menschlichen Probleme:
Jeder wirft dem anderen vor, dass er es falsch macht und jeder für sich allein, hat die rechte Methode und ist selbst der Waidgerechteste. Und so gibt es eine Menge Vorhaltungen und Belehrungen, die man sich anhören muss.
Da ist zunächst die allgemeine Klage darüber, dass bei den „Staatlichen“ zu viel geschossen würde. Und es werden eine Menge Behauptungen aufgestellt, die diesen Umstand belegen sollen:
- So würden die „Staatlichen“ angeblich rücksichtslos ernten.
Wenn es allerdings so ist, dass mit waidgerechter, klassischer Jagd[3] und unserem vorhandenen, altertümlichen Handwerkszeug[4], das Rehwild nicht ausgerottet werden kann, so zeigen die steigenden Strecken des letzten Jahrhunderts, dass sich das Biotop verändert und für das Rehwild verbessert hat. Würden die Stecken bei der heutigen, intensiven Rehwildbejagung fallen, so bedeutete dies zunächst nur, dass wir als Jäger insgesamt, mit den vorhandenen Mitteln, dauerhaft sehr effizient gejagt haben. Bislang jedoch konnte nicht festgestellt werden, dass die Rehwildpopulation gefährdet ist und das Rehwild diese hohen Strecken problemlos durch den Zuwachs kompensieren kann. Bei gleichbleibender Qualifikation der Jäger, gleichbleibendem jagdlichen Handwerkszeug und gleichbleibendem zeitlichen Jagdaufwand, bildet die Strecke die relative Population ab. Nimmt also eine Population ab, so müsste man zunächst den Jagdaufwand deutlich erhöhen, um die Strecken entgegen dem Populationstrend zu erhöhen. Weil man bei abnehmender Population nicht dauerhaft eine gleichbleibende oder höhere Strecke erzielen kann, so kann also der bis heute langfristig anhaltende Anstieg der Rehwildstrecken, nicht an einer zu starken Bejagung des Rehwildes liegen. Es verhält sich also bei der Rehwildpopulation, wie bei vielen anderen auch, dass die Population der spezialisierten Prädatoren eine Funktion der Beutepopulation und damit des Biotopes ist und nicht umgekehrt. Das heißt konkret, dass es nicht viele Rehe gibt weil es viele Jäger gibt, sondern es ist umgekehrt und die Jäger machen Strecke, weil es viele Rehe gibt. Und jedem sollte unmittelbar einleuchten, dass man nur das ernten kann, was auch vorhanden ist. Der Jäger kann nur dort jagen, wo es Jagdgründe und Wild gibt – die Städte und Stammtische sind dafür grundsätzlich untauglich.
- Die Gegner von angeblich zu hohen Strecken beim Staat, führen gelegentlich auch das Argument an, dass es so sei, dass bei scharfer Bejagung das Rehwild mit einem vermehrten Zuwachs reagierte. Es sei dies in ihren Augen nun der Beweis, dass die Strecken beim Staat zu hoch seien. Wer so argumentiert verkennt, dass die Rehwildstrecken schon seit langem, mit wenigen Ausnahmen und verstärkt seit den Nachkriegsjahren, kontinuierlich steigen. Ein solcher kontinuierlicher Anstieg wäre nicht möglich, wenn die Bejagung dauerhaft übermäßig wäre. Wer stets mit dem Argument von früheren Tagen kommt, der möge sich auch die Rehwildpopulation zu früheren Tagen betrachten: 18. Jahrhundert – weniger als ein Reh Jagdstrecke pro 100 ha Jagdfläche. Zu dieser Zeit war es also ein Glück überhaupt Rehanblick zu haben und es erlegen zu können. Wenn wir heute ein vielfaches der damaligen Rehpopulation haben, dann nur deswegen, weil in den heutigen Tagen permanent weniger erlegt wurde als nachgewachsen ist, denn sonst hätten wir heute, 2010/11, nicht Strecken von durchschnittlich 12,3 Rehen pro 100 ha Waldfläche in Baden-Württemberg[5]. Die Rehwildstrecke hat sich demnach in den letzen 60 Jahren reichlich verdreifacht. Wenn man jedoch überhaupt eine Strecke als übermäßig bezeichnen möchte, dann doch eher die damalige, denn der Eingriff in die damalige Population war größer als das heute der Fall ist. Wäre es anders, dann hätten wir heute nicht so viele, sondern immer noch so wenig Rehe. Die Strecke wäre daher meines Erachtens dann groß, wenn sich daraus eine Reduktion der Population ergäbe und sich dadurch die Strecken der Folgejahre verringerten. Da es jedoch anders ist und die Population trotz des Eingriffes permanent wächst, wird der relative Eingriff offensichtlich immer geringer.
Beim Hasen, der überwiegend im Feld und damit überwiegend bei den „Privaten“ vorkommt, dessen Strecken seit Jahren stark rückläufig sind, spricht indessen niemand über unmoralische Strecken, wenn man sich trotz rückläufiger Bestände dennoch einen Braten genehmigt. Ob der Bestandsrückgang dabei jagdliche oder andere Gründe hat, ist bei dieser Betrachtung nicht relevant und es ist auch nicht relevant, dass man für die Jagdpacht bezahlt hat und sich deswegen ein moralisches Tötungsrecht einräumt.
Würde das Argument stimmen, so wären die Jäger beim Staat diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass die Strecken seit vielen Jahrzehnten permanent anwachsen, denn sie seien ja diejenigen, die übermäßig schössen. Darüber hinaus ist es ein dummes Argument, denn wäre es so, dass vermehrte Jagd auf Dauer die Rehwildstecken erhöhte, die Rehwildpopulation also deswegen gestiegen wäre, weil in den Augen der Moralisten zu viel erlegt würde, dann sollte man auch mehr jagen und den Fleischbedarf der Bevölkerung mit Wild statt mit Viehzucht decken. Es gibt kaum ein besseres, schmackhafteres Fleisch als das vom Rehwild, es wäre also die Chance unsere Bevölkerung mit einem äußerst hochwertigen Nahrungsmittel zu versorgen – ein jagdliches perpetuum mobile. Wer dieses nicht nutzten würde, der wäre schwachen Verstandes.
Beim Rehwild handelt es sich nicht um Ratten. Das Rehwild setzt daher nur einmal jährlich, unabhängig der Bejagung. Geißen in guter Kondition setzen zwei, gelegentlich drei Kitze. Wird in den Rehwildbestand eingegriffen, dann ist genügend Raum und Nahrung für die Verbleibenden vorhanden, denn Nahrungsgrundlage wird in der Natur unter Abwesenheit von Gegenkräften, immer zuerst in maximale Fortpflanzungsrate umgesetzt und dann erst in Kondition. Es zeigt sich hier das universelle Prinzip, dass Quantität immer mächtiger ist als Qualität und was daher lebt und nach Macht strebt, das strebt nach Zahl.
Ein biologisch sinnvoller Eingriff sorgt daher für eine Verbesserung der Nahrungsgrundlage für die Verbliebenen, die dann jung und bei besserer Kondition sind. Eine gut genährte, gesunde Geiß bringt dann auch problemlos ein drittes Kitz gut über den Winter. Darüber hinaus handelt es sich auch immer um einen soziobiologischen Eingriff. Es ist also nicht nur ein Stück auf der Strecke, sondern die Territorialverhältnisse des Wildes ändern sich, was letztlich ebenfalls zu einer Verbesserung der Nahrungsgrundlage beiträgt, indem alte, stößige Geißen mit nur einem Kitz ausgedünnt werden, so dass das Wild auf gleicher Fläche bei gleichmäßig guter Kondition leben kann. Insgesamt kann man festhalten, dass bei einem biologisch korrekten Eingreifen die Situation für die Verbliebenen immer vorteilhafter ist als vor dem Eingriff.
So ist es leicht erklärbar, dass nach Jahren einer unzureichenden Jagd das Rehwild durch die Kondition begrenzt ist und bei einer scharfen Bejagung des Rehwildes, dessen Bestand kurzfristig sogar zunehmen kann. Es ist jedoch unmöglich, dass es sich um einen langfristigen Trend handelt. Zeigt der langfristige Trend daher nach oben, so wurde langfristig nicht zu viel, sondern zu wenig gejagt.
Das Prinzip, dass sich in Abwesenheit von Gegenkräften[6], eine Population tendenziell geometrisch entwickle, sich die Nahrungsgrundlage jedoch höchstens arithmetisch steigern ließe, beschrieb bereits Malthus[7], wofür er noch heute von einigen geächtet und darüber hinaus auch falsch zitiert wird. Der Streit der Ideologen und Moralisten hat also eine lange Tradition, die sich auch heute noch gerne über sämtliche wildbiologischen Untersuchungen hinwegsetzen.
- Es gibt die Behauptung, dass die Qualität der Strecke bei den staatlichen Gesellschaftjagden schlechter sei, als bei den privaten. Weil aber bei den staatlichen Jagden, die staatlichen Jäger regelmäßig in der Minderzahl sind, würde dann die kritisierte Qualität der Strecke bei diesen Gesellschaftsjagden auch anteilmäßig von den eingeladenen Gästen kommen. Hinsichtlich des Qualitätsargumentes wird in der Regel auch nicht die Trefferqualität der Schützen bemängelt, sondern die Altersstruktur der Strecke. Man bemängelt dabei vorwiegend, dass auch nicht verkaufsfähige, zu junge Rehe auf der Strecke lägen. Wer so argumentiert, der beklagt also nicht die Waidgerechtigkeit, sondern man beklagt den Nachbarn, der ebenfalls jagt und man beklagt damit die Konkurrenzsituation, die den eigenen Geldbeutel schmälert. Es handelt sich nicht um ein Argument der Wildbiologie, sondern um Beuteneid. Darüber hinaus ist es wenig sinnvoll, in einer Zeit in der die Jagd insgesamt für den Jäger ein finanzielles Verlustgeschäft ist, die Jagd mit finanziellen Argumenten betreiben und rechtfertigen zu wollen.
- Wer in einer Situation von einer permanent wachsenden Population, die angeblich zu hohen Strecken kritisiert, der plädiert für ein kümmerndes Rehwild. Es sind diejenigen, die alles auf einmal haben wollen: Billige Jagd, viel Wild bei bester Kondition, ohne Verbissbelastung des Waldes. Sie verwechseln Rehwildhege mit Schafzucht, verteidigen ihre Ideologien mit der gleichen Inbrunst wie Lenin den Kommunismus und haben eine stalinistische Toleranz. Den Gipfel erreichen Meinungsäußerungen, die einerseits die hohen Rehwildstrecken der anderen beklagen und selbst der Meinung sind, man müsse bei den Wildsauen zuerst die führende Bache erlegen, um der Überpopulation Herr zu werden. Konstruiert? Mitnichten, es handelt sich unter anderem um Aussagen von informierten, studierten, wohl situierten Bürgern – es ist auch dies eine Variante einer, wenn auch recht eigenwilligen Ethik, vor allem, wenn man zur gleichen Zeit das Handeln der anderen als unmoralisch bezeichnet.
- Ein weiteres, daran anknüpfendes Argument besagt, dass die „Staatlichen“ nur deswegen so „übermäßig Strecke“ machen könnten, weil das Rehwild aus den Privatrevieren, dort wo angeblich moralischer i.e. waidgerechter gejagt würde, in das angeblich erzeugte Vakuum des Staates abwandere. Da das Rehwild aber nicht weitläufig wandert und die staatlichen Forstreviere sehr viel größer sind als die privaten, so käme eine Wanderungserklärung nur dann in Frage, wenn es nicht nur innerhalb der Reviere sondern auch zwischen den Revieren einen deutlichen Populationsunterschied und damit Streckenunterschied gäbe.
Der Anteil der staatlichen Jagdbezirke im Wald beträgt in Baden-Württemberg 20 v.H., der staatliche Anteil der Rehwildstrecke jedoch deutlich unter 20 v.H. Da die Rehwilddichte im Wald eher größer ist als im Feld, stützen die Zahlen der amtlichen Statistik die Behauptung in keinster Weise, dass es einen beklagenswerten Unterschied in der Rehwildstrecke zwischen Privatwald und Staatswald gibt – im Gegenteil, die „Privaten“ stehen den „Staatlichen“ offensichtlich in nichts nach und so kann es auch nicht sein, dass die „Privatrehe“ beim „Staat“ geschossen werden, denn was schon tot ist kann nicht mehr wandern.
Ein Blick in die amtliche Statistik jedoch macht Arbeit, man muss sich informieren und es ist weitaus mühevoller selbst zu denken, als das für alle schädliche Geschwätz der anderen zu übernehmen. Wer sich die Mühe macht die amtliche Statistik zu studieren, der erkennt, dass die Moralisten sich hinsichtlich der Streckengröße nicht anders verhalten als der Rest, im Gegenteil. Offensichtlich sind ihnen diese Zahlen, konfrontiert man sie damit, so unangenehm, dass sie diese obendrein gelegentlich auch noch für gefälscht abtun.
Es scheint ein grundsätzliches Problem der Ideologen, dass sie denken ohne zu handeln und umgekehrt. Sie legen sich eine Position zurecht und nichts kann sie dann mehr vom Gegenteil überzeugen. Sie sind befangen, denken systemisch im Gefängnis ihrer beschränkten Gedanken, kreisen nur noch um sich selbst und scheinen der Wirklichkeit entrückt.
- So wird von den Jagdideologen aller Fakten zum Trotz, dennoch gerne weiter behauptet, dass der Verbiss eines Baumes für den Baum unschädlich sei und dieser trotzdem überlebe. Es sollte jedoch unmittelbar einleuchten, dass ein Lebewesen, Pflanzen, die permanent geschädigt und klein gehalten werden, gegenüber denjenigen benachteiligt sind, die nicht geschädigt werden. Wenn daher ein junger Baum verbissen wird und dabei nicht um kommt, so ist sein Wachstum ungleich schwieriger, als bei demjenigen, der ungehindert wachsen kann. Weil das Rehwild bei der Nahrung wählerisch ist, werden nicht alle Baumarten gleich stark beäst. Weil das Rehwild die Tanne eher beäst als die Fichte, hat die Fichte im voll besetzten Rehbiotop einen Standortvorteil und es kommt so langfristig zu einer Entmischung der Baumarten.
- Es findet sich sogar die Behauptung, dass das Wachstum eines Baumes angeregt werde, wenn man ihn beschneide oder beäse. Es ist richtig, dass derart behandelte Bäume mit vermehrtem Austrieb und Wachstum reagieren. Allerdings handelt es sich beim Verbiss nicht um einen kontrollierten Obstbaumschnitt, sondern es wird nur der schmackhafteste Teil des Baumes, in der Regel der Terminaltrieb abgebissen. Überleben solche stark beästen Bäume, so entstehen dadurch sicherlich im Alter interessante, knorrige Bäume, die jedoch keine verkaufsfähigen Erzeugnisse mehr darstellen, sondern höchstens fürs Fotoalbum herhalten können.
- Weil der Staatsforst auf einen zukunftsfähigen Wald hinarbeitet, mehr Mischwald und daher auch das Verhältnis von Tannen zu Fichten verbessern möchte, so müssen sogar gelegentlich die Tannen für die Argumentation der Staatskritiker herhalten: „Früher sind die Tannen im Rehwildrevier auch gewachsen“, so besagt ein weiterer Ruf, der sich gegen die angeblich hohen Jagdstrecken der „Staatlichen“ wendet. Das ist richtig, aber früher gab es auch deutlich weniger Rehwild und die Bäume um die man sich kümmert, können erst viele Generationen später geerntet werden. Was wir heute ernten, kommt aus Zeiten geringer Rehwildpopulation und was wir heute schützen, braucht viele Generationen und noch viel Glück, dass sie wieder geerntet werden können. Es sei in diesem Zusammenhang auch erwähnt, dass der Staatsforst an dieser Stelle ein ökologisches, damit ein nachhaltiges Ziel verfolgt und kein kurzfristig ökonomisches Ziel anstrebt, denn der Fichtenholzpreis ist höher als der Tannenholzpreis. Wenn also dem Staatsforst mit dem „Tannenargument“ zu hohe Strecken zum Vorteil des kurzfristigen Betriebsergebnisses vorgeworfen werden, so handelt es sich einfach nur um eine Unterstellung aus Unkenntnis der tatsächlichen Marktlage. Wer einen ordentlichen Lehrprinzen und ein gutes Gedächtnis hat, der weiß, dass die Fichte der „Brotbaum“ des Waldbesitzers ist und die Fichte hat eben weniger Probleme mit dem Rehwild.
- Es wird auch behauptet, man müsse nicht früh im Jahr in die Rehwildpopulation eingreifen und es wäre für das Wildpretgewicht sinnvoller die Strecke später zu erfüllen. Man könne dies problemlos zulassen, weil der Verbiss überwiegend im Winter stattfindet. Auch dieses Argument ist falsch, denn dann wenn im Frühjahr die Bäume austreiben, bilden sie für das Rehwild die schmackhaftesten Triebe. Im Frühling beäst das Rehwild sogar die frischen Fichtentriebe, wogegen es diese Baumart im Winter möglichst meidet. Hinzu kommt, dass es eine vertane Chance ist, wenn man zu Beginn der Jagdsaison eine hohe Aktivitätsphase des Rehwildes verstreichen lässt, um zu schlechteren Jagdzeiten das Streckenziel zu erreichen – auch Jäger haben nicht unendlich viel Zeit zur Jagd zur Verfügung und waidgerechte Strecke braucht Zeit. Der eigentliche Hintergrund dieses Vorwurfes ist daher nicht die Waidgerechtigkeit, sondern der niedrige Verkaufserlös eines geringen Kitzes. Wer dieses Argument anbringt zeigt, dass es ihm nicht um wildbiologische, sondern um wirtschaftliche Belange geht.
- Endlich wird weiter behauptet, die Zahlen der Forschung seien mit dem „Sägewerksblick“ entstanden, denn die Wildforschungsstellen sind staatliche Einrichtungen und würden daher forstlich genehme Zahlen produzieren. Es gibt aber neben diesen fundierten, amtlichen Zahlen nur Stammtischvermutungen und überlieferte Jagderzählungen unserer Großväter.
Wenn die Rehwildstrecken je zu hoch werden sollten, so wird sich dies automatisch relativieren und die Strecken werden trotz heftigster jagdlicher Bemühung einbrechen. Bis es soweit ist, ist es indessen sinnvoll dem Trend zu folgen und auch waidgerecht zu ernten was vorhanden ist.
#Direkt zur Erläuterung der Regel
Handelte es sich beim Staat tatsächlich um unmoralische Streckenvorgaben, so rührten diese grundsätzlich daher, dass die Ethik der Pachtgeber, des Staates, der Mitglieder dieses Staates, jeder einzelne von uns, unmoralisch sind. Der mithelfende Jäger beim Staat ist ein ehrenamtlicher Jäger der gesamten Gesellschaft und es sind die Forderungen der Gesellschaft, die er im Staatsforst umsetzen soll. Wenn er sich durch diese Forderungen unmoralisch berührt fühlt, dann muss er diesen Forderungen nicht nachkommen und er kann selbst entscheiden ob er schießt oder nicht. Wer dem Jäger beim Staat, Unmoral unterstellt, der geht davon aus, dass er selbst dieser Aufgabe nicht gewachsen wäre und selbst nicht die nötige Standfestigkeit aufweise, um seine Ethik unter diesen angeblich extremen Bedingungen umzusetzen. Der schwache Charakter mag beim Staat ein Problem mit seiner individuellen Moral haben, wenn er die gesellschaftliche Ethik unmoralischer einstufte als seine eigene - er handelte vielleicht anders, wäre er unbeaufsichtigt. Wer der Meinung ist, dass er die höchste moralische Instanz sei, nach der sich die anderen zu richten hätten, er moralischer sei als der Rest und dies dem Rest nachträgt, der hat überall ein Problem. Jagd, wie der Rest des Lebens auch, ist und bleibt eine Charakterfrage.
Die beschriebene Ideologie, eine Ethik bei der man stets beklagt was der andere tut und sämtliche Versuche einer möglichst objektiven Beschreibung der Sachverhalte für nichtig erklärt, scheint bei Licht betrachtet eine feudale Ethik zu sein, bei der man nur selbst das Rechte tut und nur selbst das Recht habe, die wirklichen Verhältnisse zu postulieren:
Zu Zeiten des Feudalismus jagte der Adel nach dem Lustprinzip. Wichtig war, dass es viel Wild gab, der Rest war Nebensache, die anderen hatten den Mund zu halten. Es gibt auch noch heute Jäger des ganz alten Schlages, die, da sie waffentragend sind, sich für Feudalherren halten und das Wild vor den Wald und vor allem ihre eigene Meinung über die der anderen stellen. Sie scheinen der Meinung, dass derjenige der bezahlt auch spricht, sie bezahlten schließlich die Jagd und also hätten sie auch das Recht auf eine Jagd nach ihrer Lust. Mit dieser Einstellung produzieren und propagieren sie eine für sich genehme Ethik des Saubermannes aber sie verkennen, dass nicht derjenige spricht der bezahlt, sondern derjenige der die Macht hat und so bezahlen am Ende immer die Schwächsten – der Jäger, das Wild, der Wald, die Landschaft. Dieses Ethikschaulaufen ist auch dem Jungjäger leichter vermittelbar als eine Jagd, die vor dem Hintergrund der biologischen Schieflage in unserer Welt eine Menge Arbeit macht und eine große Aufgabe darstellt. Jagd ist indessen heute kein bewaffneter Sonntagsspaziergang mehr, den manche für sich noch immer gerne in Anspruch nehmen - den sie haben können, wenn sie ihre Arbeit in der Landschaft ordentlich gemacht haben.
Es scheint sich daran gelegentlich der Streit mancher Jäger um die Jagd zu entzünden. Während die einen noch immer auf ihrer feudalen Privatwolke vor 1848 schweben, sind die anderen bereits in der Jetztzeit angekommen. Vor 1848 herrschte der Adel und jagte nach dem Lustprinzip. Es hieß „Wild vor Wald“, der Adel hatte genügend Grundbesitz und es kam auf ein paar Bäume nicht an. Er hatte auch genügend zu essen und so war es auch für sie nicht weiter schlimm, wenn die Ernten der Bauern zwischendurch etwas kärglicher ausfielen. Dann, 1848, nach der Revolution, fielen kurzzeitig die Schranken und die hohen Wildbestände wurden durch jedermann drastisch dezimiert. Zum Glück konnte diese Praxis vom Adel und den Förstern wieder eingedämmt werden und man konnte das neue Denken, der Hege mit der Büchse, 1934 im Reichsjagdgesetz verankern. Diese Hege mit der Büchse legte fest, dass der Jäger für einen artenreichen und der Landschaft angemessenen Wildbestand sorgen müsse. Damals wusste man noch nichts über das Hasen- oder vielmehr das Artensterben, mit verursacht durch eine mechanisierte, chemische ausgerichtete Landwirtschaft und einen hemmungslosen privaten Verbrauch. Wir haben daher nicht nur eine Schieflage bei manch jagendem Mitbürger, sondern vor allem in unseren Biotopen, unserer Landschaft, in denen auf der einen Seite die Artenvielfalt abnimmt und einzelne Arten an andere Stelle relativ zahlreich auftreten.
Es bedarf keiner hellseherischen Fähigkeiten, dass diese Schieflage zukünftig zunehmen wird, wenn wir täglich über 100 ha Landschaft betonieren und so weiter machen wie bisher. Wir werden daher zukünftig sicher weniger Jagdgründe haben und die ökonomischen Interessen der Privatwirtschaft, also auch der privaten Land- und Forstwirtschaft, werden in der Knappheit zukünftig eher mit härteren Bandagen ausgetragen, als mit einem Blick auf die Natur und die Landschaft. Mit knapper werdendem Land wird es teurer werden und die Intensivierung wird zunehmen. Die originäre Jagd wird also zukünftig grundsätzlich einen immer kleiner werdenden Stellenwert haben. Feudale Jagdgedanken sind daher doppelt kontraproduktiv, denn sie verhindern einerseits eine geschlossene Jägerschaft und klären andererseits diejenigen nicht richtig auf, die die Jäger weiterhin Jäger sein lassen sollen und dafür sorgen können, dass die originäre Jagd erhalten bleibt.
Die Jagd zeigt den Charakter eines Menschen schnell und eindeutig, indem man beobachten kann inwieweit seine Reden mit seinem Handeln im Einklang stehen. Die Einteilung der Lebewesen in Schädlinge und Nützlinge ist eine Einteilung nach persönlichen Interessen, wir sollten als Mensch, aber vor allem als Jäger, vollständig von dieser Einteilung abrücken und jedes Leben als einen notwendigen, sinnvollen Teil der Schöpfung verstehen, in dem jedes Lebewesen seine Berechtigung hat, unabhängig von seiner Größe und seinem unmittelbar erkennbaren Nutzen für uns selbst. Wenn wir uns gesellschaftlich so verhalten, dass in unserer Landschaft Gift nötig ist, um den Ertrag zu steigern, dann stimmt etwas mit unserer Ethik nicht. Es gilt grundsätzlich, dass wir unsere Unfähigkeit biologisch ordentliche Arbeit zu leisten nicht mit Vergiftungsmaßnahmen kompensieren sollten. Wo moderne Mechanik und aktuelles Agrarwissen nicht mehr ausreichen, da ist nicht das Gift die Antwort, sondern eine andere Ethik. Es kann dies keine Ethik der Gewinnmaximierung sein, sondern eine natürliche, biologische Ethik.
Das steht nicht im Widerspruch dazu, dass wir ein Reh lieben, weil wir es gerne essen. Aber man kann das Reh lieben und muss deswegen die Zecken, die sich darauf niedergelassen haben nicht hassen. Ein Jäger handelt dann im universellen Sinn, wenn er aus tiefster innerer Überzeugung sagen kann, dass er sich durch sich selbst bejagen lassen würde – sehr wahrscheinlich würde dann mancher Schuss unterbleiben, wenn der Jäger das Leid aushalten müsste, was er unüberlegt und leichtfertig anrichtete. Und um diesen Gedanken noch ein wenig zu erweitern, bin ich der Meinung dass dies nicht nur für die jagdbaren Wildtiere gilt, sondern für alle Tiere. Wenn ich mir ansehe, wie wir in der Massentierhaltung mit anderen Geschöpfen, mit Leben, mit unseren Brüdern umgehen, dann kommen mir die Tränen. Und es soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass nicht die Größe und die Leistung eines Lebewesens darüber entscheiden sollte, wie man mit ihm verfährt, wie man es behandelt, denn eine Maus lebt ohne Zweifel genauso gern wie ein Elefant und weil wir uns aus der Schöpfung nicht ausnehmen können, gilt das auch für den Menschen.
Heute, da in der ersten Welt keiner mehr verhungert und selbst der Ärmste in der Gesellschaft nicht mehr nur von Kartoffeln und trockenem Brot lebt, könnten wir als Jäger freier, unabhängiger entscheiden den je, denn wir müssen kein persönliches, unmittelbar existenzielles Interesse mehr an der Jagd haben, wir können uns vollständig einem ganzheitlichen, biologischen Denken, und der Ursprünglichkeit der Jagd hingeben und müssen keine Interessengruppen[8] bedienen und keinem nach dem Mund reden. Jagd war noch nie, zu keiner Zeit, so leicht und so frei wie heute – wenn wir den entsprechenden Charakter dazu aufbringen[9].
Es wird immer so sein, dass es ein moralisches Argument gibt, welches das eigene Handeln oder Nichthandeln legitimiert. Wir sollten jedoch grundsätzlich nicht vergessen, dass nur das allgemein als schön empfunden wird, nur das Bestand hat, wofür ein allgemeines Interesse vorhanden ist und was gesellschaftlich insgesamt getragen wird. Mit diesem Hintergrund sollten wir aus jagdlicher Sicht dankbar sein, dass der Jäger noch ein ökonomischer Faktor in der land- und forstwirtschaftlichen Produktion darstellt. Denn wäre es anders, so wäre die Jagd bald gänzlich abgeschafft. Wir müssen daher froh sein, dass wir als Jäger noch keine Ausstellungsstücke fürs Museum sind, sondern noch benötigt werden. Es hat nichts mit Schädlingsbekämpfung zu tun, wenn wir eine gesellschaftlich sinnvolle Aufgabe erfüllen, ein Produktionsfaktor sind und Freude bei der Arbeit haben, das ist heute eine recht seltene Kombination und wird daher stets mit Argwohn betrachtet: Wenn jemand Freude bei der Arbeit hat, da muss etwas faul sein, denn viele haben ein Problem damit, was letztlich jedoch nur den Zustand unser menschenverachtenden, lebensfeindlichen Epoche widerspiegelt.
#Direkt zur Erläuterung der Regel
Es gibt für niemanden etwas zu beklagen, sondern man kann sich sinnvoll nur im Sinne des Lebens intelligent verhalten. Man kann daher die Verantwortung des Handelns, des Jagens, des Tötens nicht an eine Institution oder an eine andere Person abgeben, denn diese Verantwortung ist individuell. Es ist nicht der Staat der jagt, nicht der Förster, nicht der Jagdherr, nicht die Situation – es ist jeder einzelne Jäger der jagt und daher ist Tod der Tod, Leid ist Leid, Fehler ist Fehler und nur das überzeugende Ergebnis des Jägers oder allgemein des Handelnden, des Lebenden zählt. Weil der Mensch nicht von Geburt an sein Handwerk beherrscht, so wird jeder einzelne für sich und jede Generation die gleichen und ähnliche Fehler wieder aufs neue machen. Man muss daher auch fehlertolerant sein, aber nicht aus moralischen Erwägungen, sondern aus der Situation der grundsätzlichen Fehlbarkeit des Menschen heraus. Jeder sollte bestrebt sein, seine Arbeit ordentlich zu machen, das ist er seinem Menschsein und der Verantwortung auf Grund seiner Erkenntnis schuldig. Weil es bei jagdlichen Fehlern nicht um irgend einen Fehler, sondern um das Leben eines Bruders, eines Lebewesens geht, ist die Jagd nicht nur die elementarste, sondern auch die wichtigste Disziplin des Menschen. Bei der Jagd erkennen wir, dass wir über Leben und Tod entscheiden, hier muss es uns bewusst werden. Und wer zur Jagd geht und über sein Handeln nachdenkt, der erkennt auch, dass wir bei unseren Handlungen eigentlich immer direkt oder indirekt über Leben und Tod entscheiden. Es wird uns anderswo nicht immer bewusst oder wir verdrängen es gerne und deswegen setzen viele bewusstlos jedes Gift ein, nutzen jede Möglichkeit, um ihr persönliches Ziel billig zu verfolgen.
Bei der Jagd ist das Thema der Ethik nicht zu verdrängen, man muss sich der ungeschönten Wirklichkeit stellen und man muss sich vor sich selbst verantworten, ob man will oder nicht. Auf der anderen Seite sterben keine kleinen oder gar unsichtbaren Tiere. Man kann sehen wie auf der anderen Seite der Büchse gestorben wird, man ist unmittelbar dabei, man kann es nicht verdrängen, dass man als Jäger auch der Verursacher des Todes ist. Es ist der Jäger, der den Finger krümmt, nicht ein anderer. Viele, die aber dem Jäger genau das vorwerfen und meinen selbst nicht zu handeln, die verdrängen, dass durch ihr Handeln oder auch Nichthandeln Massensterben, Artensterben verursacht werden – ansonsten müssten sie das Licht am Abend ausmachen.
Diejenigen, die das staatliche System kritisieren, aber selbst eine Jagd privat gepachtet haben, sind grundsätzlich in der gleichen Lage wie der Jäger, derjenige die Jagdmöglichkeit beim Staat erwirbt. Es handelt sich um grüne Jäger im grünen Wald.
Derjenige der die Jagd insgesamt kritisiert, tötet auch oder er lässt töten. Wer lebt und leben will, der tötet, der muss töten und die Größe des getöteten Lebewesens liefert auch nicht die moralische Rechtfertigung dafür. Aber wer erkennt, der muss sich auch verantworten und das ist häufig das eigentliche Problem, weshalb man nicht zur Jagd geht, weshalb man das Reh bedauert, die Fliege an der Wand genervt erschlägt oder gar nicht gewahr wird, wie viel Leben man durch seine sonstigen Tätigkeiten vernichtet. Wäre die Jagd ein lukratives Geschäft, so wären häufig auch bald die Argumente für die Jagd gefunden.
Aber so wie jeder von uns nicht in einer eindimensionalen Zielfunktion steckt, und nicht bedingungslos an Grundsätzen festhalten kann, so hat nicht nur der Jäger, sondern auch der Förster ein Problem, denn von ihm wird forstliche Effizienz verlangt. Es ist daher ein großer Verlust, dass der Förster nicht zwangsläufig auch Jäger sein muss und die Forstreviere aus betriebswirtschaftlichen Überlegungen permanent gewachsen sind. Diejenigen, die aber die jagdliche Moral des Forstes, des Staates auf der einen Seite beklagen, beklagen häufig gleichzeitig, wenn der Förster andererseits dienstlich, also bezahlt, zur Jagd geht, während sie dafür bezahlen müssen – ideologischer Sozialneid. Sie beneiden auch den Koch wenn sie Hunger haben und allen von denen sie vermuten, es ginge denen gerade besser als ihnen selbst.
Es ist die Entwicklung, hin zur Segmentierung in einer ökonomisch geprägten Welt, dass der Staat und seine Stellen versucht sein könnten, ebenfalls zu einer betriebswirtschaftlichen Denkweise zu verkommen. Der Staat sollte in den eigenen Reihen nicht Marktwirtschaft betreiben wollen, sondern die Voraussetzungen dafür schaffen. Der Staat muss Aufgaben übernehmen, die ein Wirtschaftsunternehmen nicht leisten kann und sollte daher umgekehrt auch nicht versuchen ein Wirtschaftsunternehmen zu werden und sich mit einem solchen vergleichen zu wollen. Wo der Staat anfängt, sich betriebswirtschaftlich mit einem Privatunternehmen zu vergleichen, da ist von vorn herein klar, dass dies aufgrund des vorhandenen Zielkonfliktes nichts werden kann. Man könnte daher auch darüber nachdenken, ob nicht unverbautes Land, die kärglichen Reste von relativer Natur, als unser zukünftiges Brot, als unsere Grundlage, in privaten Händen weniger optimal aufgehoben sind als in staatlichen und ob die private, durchschnittliche Zeitpräferenz das Maß aller Dinge sein soll. Eine voranschreitende Privatisierung der öffentlichen Hand zeigt jedoch in eine andere Richtung, in eine Richtung eines beschleunigten Verbrauches unserer Grundlagen. Wir schönen unsere finanziellen Bilanzen mit einem Verkauf der Zukunft.
Und so treffen im Wald grundsätzlich zwei Positionen aufeinander:
Die eine Position heißt „Wald vor Wild“, es ist die ökonomische Position der betriebswirtschaftlich orientierten Forstwirtschaft, die Position des Waldeigentümers mit rein monetärem Blick. Es ist daher die Position der Marktpreise und es ist eine Position des modernen vollbesetzten Biotopes der Moderne.
Die Gegenposition heißt „Wild vor Wald“, es ist eine Position der leichten Jagd, deren Ursprung in einer feudalen Gesellschaft zu suchen ist.
Die Synthese zwischen Feudalismus und Individualismus: „Wild und Wald“ ist eine enorme politische Leistung unseres individualistischen Gesellschaftssystems, des aktuellen deutschen Staates, wird vom deutschen Staatsforst vertreten und steht endlich auch in den Papieren der Jagdverbände - nur umgesetzt werden muss dieses offizielle Lippenbekenntnis noch. Gleichwohl steht dieser sinnvolle Grundsatz im Gegensatz zu vielen Meinungen der Vormoderne, im Gegensatz zum marktwirtschaftlichen Prinzip, im Gegensatz zur Meinung von einigen und ist daher hinter vorgehaltener Hand immer wieder heftig umstritten.
Es sind daher nicht nur einfach zwei Positionen, die im Wald aufeinander treffen, sondern die Vormoderne trifft auf die Moderne. Während dieser Kampf außerhalb des Waldes schon längst entschieden ist, ringen die beiden im Wald immer noch miteinander. Der Wald ist demnach nicht nur ein Reservoir der Biodiversität, sondern auch ein Reservoir einer natürlichen Ethik. Die feudale Jagd war vorgestern, der Individualismus läutet das Ende der Jagd ein. Die Synthese von Wild und Wald ist die einzige Chance für die Jagd, für das Wild und für den Menschen zu überleben. Der Wald und die natürliche Ethik, die sich daraus ergeben kann, wären daher am sinnvollsten in den Händen eines gut funktionierenden, effizienten Staates aufgehoben.
#Direkt zur Erläuterung der Regel
Neben den beschriebenen, allgemeinen menschlichen Problemen sind es aber auch die Probleme der Jagd, des Handwerks. Und so ist daher bei den Reden alles ganz einfach – bis man mit den Taten angefangen hat!
Es gibt vermutlich wenig Differenzen darüber wie eine wildbiologisch gut aufgestellte Population aussehen soll. Und um diese herzustellen hat ein Jäger die Möglichkeit einzugreifen, das heißt nicht nur Maulaffen feil halten, sondern etwas zu tun. Die Hege mit der Büchse ist eine unbestritten wirkungsvolle Maßnahme, nur die Details sind natürlich verschieden und heftigst diskutiert.
So unternimmt von Raësfeld den Versuch der Zählung und der Abschussplanung. Er schreibt auch von einem Beamten, der dies bewerkstelligen soll. Dass es zur Zeit Raësfelds einen Beamten - er meint den Förster - gegeben hat, der damals offensichtlich die Zeit hatte, sich neben der Holzwirtschaft um die Zählung des Wildes zu kümmern, zeigt die Wertschätzung der damaligen Gesellschaft für das Wild. Das Wild hatte offensichtlich einen ganz anderen Stellenwert als dies heute der Fall ist und man war auch bereit ordenltich dafür zu bezahlen.
Aber selbst wenn man die damaligen Verhältnisse wieder herstellen wollte und die Anzahl der Förster verzehn- oder verhundertfachte, so könnte man das Rehwild dennoch nicht zählen.
Ich habe als Waldjäger die Erfahrung gemacht, dass man trotz häufiger Präsenz einen Bock nur selten zweimal sieht und das auch nur dann, wenn man seinen Wechsel kennt. Wer einen Abschussplan im Wald zu erfüllen hat, der äugt das Wild, spricht an, schießt oder lässt es bleiben. Der Blickwinkel und die Distanzen im Wald sind derart eingeschränkt, dass für eine Entscheidung wenig Zeit bleibt. Es kommt der Umstand dazu, dass wir das Fremde, mit dem wir nicht ständig zusammen leben, nur schwer eindeutig erkennen können. Wir sehen eine fremde Menschenrasse und haben Schwierigkeiten die Individuen eindeutig auseinander zu halten. Ich halte es beim Rehwild für ausgeschlossen, die einzelnen Rehe über einen längeren Zeitraum individuell bei zwei Anblicken zu unterscheiden, es sei denn, sie haben ganz besondere Merkmale, an denen man sie erkennen kann, wie zum Beispiel ein abnormes Gehörn beim Bock, eine Verletzung, ein besonderes Merkmal, das sofort ins Auge fällt. Man sehe sich nur zehn Schafe auf einer Weide eine halbe Stunde lang an, komme schon am nächsten Tag wieder und versuche die Individuen eindeutig zu identifizieren.
Als Jäger kann ich jedoch sehr gut entscheiden ob ein Stück in guter oder schlechter Kondition befindet, ob jünger oder älter und zwar unabhängig der Knochen, die sich auf dem Schädel befinden.
Wenn wir uns diesem Umstand bewusst sind, dann sollten wir nicht danach trachten starke Böcke zu haben, sie züchten zu wollen, wir müssen im Umkehrschluss so handeln, dass sie sich automatisch ergeben. Starke Böcke sollten nicht das Ziel, sondern nur die logische Konsequenz unserer Jagd sein.
#Direkt zur Erläuterung der Regel
Hierzu sind die Populations- und Abschussüberlegungen von Raësfeld hervorragende theoretische Überlegungen[10] - man mache sich die Mühe und lese nach!
Es ist vermutlich ebenfalls unstrittig, dass die Reproduktion beim Rehwild von den weiblichen Stücken abhängig ist. Die Geißen werden alle Jahre beschlagen und tragen tapfer ihre Kitze aus, ihre Aufgabe besteht daher darin für die Quantität zu sorgen, denn alle gesunden Geißen wollen beschlagen sein und so haben sie alle Jahre Nachwuchs bis ans Ende ihrer Tage.
Bei den Böcken verhält es sich ein wenig anders: Wohl kommen auch geringere Böcke zum Zug, aber es pflanzt sich vornehmlich der territoriale Bock fort. So sorgen die Böcke nicht vornehmlich für die Quantität sondern durch eine Auslese untereinander für die Qualität. Auf diese Weise ergänzen sich beim Rehwild das Weibliche und das Männliche und so wird über die Quantität und die Auslese die Qualität gesichert.
Die erfahrensten, intelligentesten, schlausten Böcke werden am ältesten; der Jäger sieht sie so gut wie nie und sie pflanzen sich alle Jahre fort – so die Population einen ausgeglichen, altersgerechten Aufbau hat. Das heißt, dass der Jägers mit seinem Eingriff, so hoch oder so niedrig wie er auch sei, darauf bedacht sein sollte einen natürlichen Altersaufbau einer Population zu erreichen respektive bei zu behalten, denn dadurch wird die Selbstregulation der Qualität einer Population erreicht. Wir können als Jäger daher die Qualität einer Population nur über die Quantität des Abschusses erreichen[11]. Ist der Altersaufbau innerhalb der Population gestört, gibt es keine alten territorialen Böcke mehr, so pflanzt sich fort was gerade zur Stelle ist, wenn die Geiß beschlagen werden will. Wollen wir derzeit weniger Rehwild in besserer Kondition, so müssen wir bei den Geißen anfangen. Und so muss die Rehwildjagd nicht im jeweils aktuellen Jagdjahr beginnen, sondern bei der Geißenjagd des Vorjahres.
Die Geißenjagd ist indessen ein Problem. Eine Geiß ist nach ein paar Jahren hoch erfahren und daher nicht nur aufgrund ihrer Weiblichkeit von Haus aus vorsichtig, sondern auch aufgrund ihrer Erfahrung. Eine älter gewordene Geiß hat als Kitz erlebt, dass mit dem Knall ihr Bruder stirbt. Dann knallt es alle Jahre wieder und ihre Kitze sterben und zwar immer an den gleichen Stellen. Will ein Jäger eine Geiß waidgerecht erlegen, dann muss er zunächst ihre Kitze erlegen. Eine erfahrene Geiß, und das ist fast jede die zum ersten Mal ihre Kitze überlebte, wird nicht still halten und warten, bis sie an der Reihe ist. Der Jäger, der diese Geiß erlegen will, der muss sie also, hat sie zwei Kitze, mindestens zwei bis dreimal sehen und er muss sich Zeit mit dem Ansprechen lassen, er muss sicher gehen, dass sie nicht mehr führend ist.
Die Jagd im Winter auf die Geiß ist daher nicht zuletzt aufgrund der äußeren Umstände um ein vielfaches beschwerlicher als die leichte Bockjagd bei frühlingshaften Temperaturen. Im Winter ist es kalt, es ist feucht, die Tage sind kurz und so könnte der Jäger gelegentlich leicht in Versuchung geraten, zu Hause zu bleiben, um der Versuchung des warmen Ofens zu erliegen. Denn es lassen sich leicht Gründe finden, die Unbequemlichkeiten zu unterlassen, die man noch als gute Vorsätze bei einer erfolgreichen Bockjagd beschloss. Zur begrenzten Tageszeit kommen an den Winterwochenenden die Jagdeinladungen zu den Gesellschaftsjagden dazu, die das Zeitbudget für den Geißenabschuss im eigenen Revier auch nicht weiter verbessern.
Ich fasse das Problem zusammen: Im Wald sieht man den Bock, es fällt eine schnelle Entscheidung und dann ist er in der Regel tot. Die erfahrene Geiß mit Kitzen muss man unter erschwerten Bedingungen mindestens dreimal sehen und sich bei der Geiß ordentlich Zeit für die Entscheidung lassen. Eine Geiß hat neben ihrer erhöhten Erfahrung mit dem Jäger, daher schon allein aufgrund der Wahrscheinlichkeit des langen Mehrfachanblickes, eine um ein Vielfaches größere Überlebenschance als ein Bock. Hinzu kommt die Moral, die es manchem auch nicht gerade leichter macht, die Geiß, die Mutter aller Kitze, die Mutter des Lebens, zur Strecke zu bringen.
Dem Jäger fällt der Bockabschuss zu Jagdbeginn, vom Gehörn und der Moral einmal ganz abgesehen, um ein vielfaches leichter als ein qualifizierter Geißenabschuss zum Ende der Jagdzeit unter beschwerlichen, winterlichen Verhältnissen. Die Rehwildjagd sollte sich daher nicht am Jagdjahr sondern am Rehwildzyklus orientieren. Der Geißenabschuss fängt daher sinnvoll mit dem Jagdjahr so an, indem man die Geißen beobachtet. Wo taucht welche Geiß, mit welchen Kitzen auf. Dann zur Eröffnung ihrer Jagdzeit, fängt man sofort bei den Kitzen an, um endlich im Winter, wenn man den Sommer über verantwortungsvoll gearbeitet hat, man weiß wo man hin muss. So kann man die größeren Sippen schonen und erlegt so automatisch die Geißen, die eine schwächere Kondition haben. Rehwildjagd ist daher in erster Linie eine verantwortungsvolle Geißenjagd.
Es ist leicht einzusehen, dass dies ein hartes Stück Arbeit vor dem Winter ist. Man kann nicht einfach kurz vor dem Ende der Jagdzeit kommen und sagen, so jetzt erledigen wir noch schnell den Geißenabschuss, indem wir soviele Geißen erlegen, wie wir Böcke erlegt haben. Wer so verfahren will, der hat dann kann keine Wahl mehr, denn er will oder muss die Quote erfüllen. Quotendenken geht jedoch immer zu Lasten der Qualität. Quotendenken ist moralisches Denken, macht die Zahlen auf dem Papier glatt, ist aber für eine Qualitätssteigerung kein geeignetes Mittel der Wahl – nicht bei der Rehwildjagd und auch nicht sonstwo. Wir sollten also nicht die Geißenzahl dem Bockabschuss anpassen, sondern umgekehrt.
Nun kommen aber noch die persönlichen, die individuellen Probleme des Jägers zum tragen und deswegen wurden in der Vergangenheit immer mehr Böcke erlegt als Geißen. Die Argumente sind in der Regel die gleichen wie bei den allgemeinen, menschlichen Problemen – sie sind mehr oder weniger beliebig und wenn man sie hinterfragt, immer mehr oder weniger plausibel.
Jagd ist dann erfolgreich und gut, wenn sie mit Kontinuität und Verstand betrieben wird. Es muss daher eine Regel her, die jeder für sich individuell, ohne feste Zahlenvorgabe, ohne Quote, für den Abschuss einhalten kann. Funktioniert das freiwillige, individuelle Handeln nicht, dann gibt es auch kein gutes gemeinsames Ergebnis. Es muss ein Vorschlag sein, bei der der Einzelne nicht sagt, es nutze ja doch nichts, wenn er sich wildbiologisch sinnvoll verhalte und alle anderen machten es falsch – das darf uns nicht interessieren! Jeder der da raus geht, jagt und etwas tut, was andere nicht tun wollen, tut es nicht nur freiwillig, sondern er bezahlt auch noch dafür. Eine Regel darf ihm daher nicht auch noch sein Gewissen belasten, sondern er muss sie gerne und leicht erfüllen können. Man kann daher nicht die Quote für ein gutes Gesamtergebnis vom Einzelnen fordern, ohne ihn ständig kontrollieren zu müssen, aber man kann jedem den folgenden einfachen Vorschlag anbieten:
- Der Bockabschuss soll nicht oder nur unwesentlich höher sein, als der Geißenabschuss[12] des vorherigen Jagdjahres. Die Böcke werden zu Beginn des Jagdjahres ohne Auswahl in der Reihenfolge erlegt, wie sie kommen, je eher die Zahl erreicht ist, desto besser. Wer etwas besonders tun möchte, der kann den einjährigen Spießer pardonieren, dessen Spieße überlauscherhoch sind, denn dieser beweist eine gute Kondition und gutes Potential.
- Mit Beginn der Jagdzeit für Kitz und Geiß wird sofort jedes erlegbare Kitz ohne Wahl erlegt. Wenn, dann pardoniere man die Sippe einer strammen Geiß mit drei Kitzen[13].
- Jedes weibliche Stück, das dann in der Jagdzeit nicht mehr führend angetroffen wird, kann erlegt werden.
- Aus dieser Zahl ergibt sich dann der Bockabschuss des Folgejahres und so fort.
Es ist auch nach dieser Regel[14] nicht sichergestellt, dass genügend gejagt wird - aber es wird wenigstens in die richtige Richtung gejagt und muss darum oberste Priorität haben.
Der Gelegenheitsjäger wird sich Mühe geben müssen, damit er überhaupt so weit kommt, dass er eine Geiß waidgerecht erlegen kann, um im nächsten Jagdjahr einen Bock schießen zu können. Wenn eine Geiß in der Regel zwei Kitze führt, so muss er für jeden Bock den er erlegen will, vorher durchschnittlich drei andere Stücke erlegen, an die er wesentlich schwieriger heran kommt, als an einen Bock. Es mag sich ein jeder selbst ausrechnen, wie viele Stunden er vor seinem Bock jagen muss, bevor dieser an der Reihe ist. Wer nur alle Jahre seinen Bock schießen will, der greift nicht sinnvoll in die Rehwildpopulation ein. Der fleißige Jäger muss nicht im Herbst und Winter bangen, damit er seine Geißen zusammen bekommt, um ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis bei der Strecke zu haben – er schafft es schwerlich, wenn er sich an den Böcken statt an den Geißen orientiert.
In einigen Bundesländern wird der winterliche Bockabschuss nicht mehr bestraft, manche plädieren sogar dafür, die Bockjagd auch auf den Winter zu erstrecken. Es ist dies eine größere Freiheit für den Jäger. Mehr Freiheit, bedeutet jedoch nicht automatisch, dass man diese bewusst und grundsätzlich auch nutzen soll, denn die Freiheit schränkt sich mit ihrer Inanspruchnahme ein. Aber es ist ein unschätzbarer, zu begrüßender Umstand, wenn man nicht für jeden Fehler der einem unterläuft auch gleich juristisch belangt werden kann. Ein System muss fehlertolerant sein, sonst sitzt entweder ein Verbrecher oder ein verängstigter, zaudernder Jäger auf dem Hochsitz. Macht er einen unbeabsichtigten Fehler und erlegt zur Winterzeit einen Bock, so bricht die Rehwildpopulation nicht zusammen, wenn er sich ansonsten an die Regel hält. Es ist dies kein Plädoyer für die späte, die faule Bockjagd, sondern ein Plädoyer für die Freiheit, denn wer nach den gemachen Grundsätzen ordentlich jagt, der ist ohnehin bei Zeiten mit der Bockjagd fertig, weil er gar nicht so viele Geißen waidgerecht erlegen kann wie Böcke. Eine frühe und bei Zeiten abgeschlossene Bockjagd lässt darüber hinaus im Revier auch eine Ruhephase zu.
Und so macht ein jeder was er kann, wozu er zeitlich in der Lage ist und alles wird gut:
Man muss damit dem Jungjäger auch nicht mit spartenfremden Auflagen wie Fuchsabschuss, Revierarbeiten etc. aufwarten, diese verstehen sich von selbst, sondern lässt ihn mit dieser Regel selbständig arbeiten – es wird zur Freude beider sein. Und man muss sich als Jungjäger auch nicht bei einem Jagdherren den Stress antun, dem der Bock nie reif und die Geiß stets zu gut war, wenn sie auf der Strecke liegt. Wer den Jungjäger kritisiert, der muss ihm auch erklären warum, das gilt im Guten wie im Schlechten und was noch wichtiger ist, er muss ihm mit gutem Beispiel voran gehen.
Unter der Maßgabe, dass der Jäger auch jagt und nicht zu Hause sitzt, ergibt sich aus dieser einfachen Regel, dass man die Böcke nach den Geißen erlegt, automatisch ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis. Handelt es sich um einen fleißigen Jäger, so ergibt sich automatisch eine angepasste Stückzahl, der einzelne Jäger kommt nicht in Stress und Erklärungsnöte. Sollte entgegen dem Trend des letzten Jahrhunderts der Bestand abnehmen, so werden auch die Strecken automatisch zurück gehen und der Bestand stabilisiert sich, denn der Zeitaufwand für die waidgerechte Jagd steigt mit abnehmender Population und ein Jäger hat nicht beliebig viel Zeit. Man jagt damit tendenziell auf einen guten Altersklassenaufbau des Rehwildbestandes hin und man greift in die Population ein, was der Sinn der Sache ist. Beides, die gesunde, ausgeglichene Population und deren verminderte Zahl, tragen zu einem verminderten Verbiss, zu einem gesunden Mischwald und einem guten Braten bei.
Vielleicht geht es ja doch im gemeinsamen Blick des Jägers und Försters – Wald und Wild!
Und wenn wir es genau überlegen, so gibt es auch keine andere Wahl, denn wo soll das Wild sonst hin und wo soll es sonst herkommen?
[1] Von Raësfeld, Ferdinand, kgl. Preuß. Forstmeister in Born auf dem Darß; Das Rehwild, Verlag von Paul Parey in Berlin, 1906.
[2] BJagdG; Ausfertigungsdatum: 29.11.1952
[3] Es ist mir kein Fall bekannt, dass mit waidgerechter Jagd eine Tierart ausgerottet wurde, im Gegenteil. Kommt es zu einem Sterben einer Art oder zu einem allgemeinen Artensterben, so war nie die waidgerechte Jagd die Ursache.
[4] Man sollte die Jagdwaffe beibehalten, den ein mehr an Technik und Chemie verbessert die Einstellung des Menschen zur Jagd nicht. Das heißt ich bin gegen die Nachtjagd mit Nachtsichttechnik, denn sie wird die Probleme nicht beseitigen. Problematisch sind nicht die technischen Möglichkeiten, das Machbare, sondern derjenige der sie anwendet.
[5] Jagdbericht Baden-Württemberg 2010/11; Wildforschungsstelle Aulenendorf.
[6] Gemeint waren die apokalyptischen Reiter, in Form von Krieg, Not, Tod, Seuchen, Hungersnöte und sonstige Katastrophen.
[7] Malthus, Thomas Robert (1766-1835); Principle of Population, London, 1798
[8] Die fanatischen Jäger, wie die fanatischen Jagdgegner leiden beide an der gleichen Krankheit - der Hybris der eigenen Überbewertung.
[9] BLEY, Fritz: „Des Menschen Würde ist in eure Hand gegeben, bewahrt sie wohl!“ Vom edelen Hirsche, Voigländers Verlag Leipzig 1923, a.a.O. Seite 587
[10] Vergl., ders., Seite 359 ff.
[11] Es ist ein interessanter Gedanke, dass dieses Prinzip mit einiger Wahrscheinlichkeit universeller Natur sein könnte und so wäre die Ausprägung der Intelligenz, die Wachheit des Lebens, nur über Katastrophen zu erreichen. Es bedeutete dies, dass sich die Arten vermehren bis sie an ihre Grenzen kommen und erst dann, wenn der große, der universelle Jäger auf den Plan tritt, Arten sterben lässt, das Biotop völlig neu gestaltet, die Erde schüttelt und umkrempelt, erst dann wird wieder der Grundstock für einen Quantensprung gelegt – Zeit ist dafür genügend vorhanden, nur erkennen wir das mit einer Lebenserwartung einer Eintagsfliege oft nicht.
[12] Schmalrehe werden wie Geißen behandelt.
[13] Es ist einfacher einer Geiß ein Kitz zu nehmen als drei, hinzu kommt, dass die Geiß mit den drei Kitzen in besserer Kondition und Alter eher zu pardonieren ist, als diejenige die nur eines hat. Wenn schon, dann empfiehlt sich die sippenhafte Bejagung der kleinen Sippe, denn am Ende schafft man es nicht sich bis zur Geiß vor zu schießen und richtet einen größeren Schaden an, als wenn man ihr alle Kitze lässt, sie nicht in Angst und Schrecken versetzt und sich am Anblick erfreut. Man schafft sich nur ein zukünftiges Problem, wenn man seine eigentliche Absicht, die Geiß am Ende zu erlegen, nicht in die Tat umsetzen kann, weil die Aufgabe einfach zu hoch angesetzt war und man züchtet sich so eine alte, stößige Geltgeiß ins Revier.
[14] Der mithelfende Jäger beim Staat hat nichts vom Bock und nichts von der Geiß – außer Kosten und Arbeit - er hat sie beide abzuliefern. Es sollte ihm also leicht fallen nach dieser Regel zu jagen.